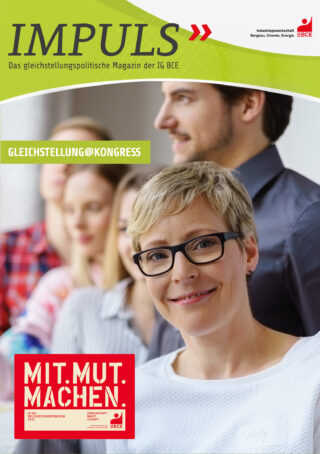Silke Raab
Foto: Raphael Dau
Vorgestellt von Silke Raab, Referatsleiterin in der Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik beim DGB Bundesvorstand Verantwortlich u. a. für Gleichstellungsorientierte Familienpolitik
Unbezahlt und unentbehrlich: die gesellschaftlich notwendige Arbeit
Sie wird kaum wahrgenommen, ist unbezahlt und auch sonst wenig wertgeschätzt – und doch findet sie statt: die Sorgearbeit. Und sie wird ganz überwiegend von Frauen geleistet.
Dabei beinhaltet der Begriff der Sorgearbeit nicht nur den Nachmittagsspaziergang mit dem schlafenden Neugeborenen im Kinderwagen, die tröstende Umarmung, wenn sich der Nachwuchs das Knie aufgeschlagen hat, oder die Gute-Nacht-Geschichte auf der Bettkante. Auch das Rasenmähen im Garten des gesundheitlich angeschlagenen Vaters, der Arztbesuch mit der Mutter oder die täglichen Bewegungsübungen mit dem Kind, das besondere Förderung benötigt, gehören dazu.
Außerdem, nicht zu vergessen: waschen, räumen, kochen, putzen – Hausarbeit eben. Und nicht zuletzt, wenn auch vollständig unsichtbar: die Planung des Alltags, die Besorgungen, die Erledigungen mit Wege- und Wartezeiten, die Koordination der Termine im Tages- und Wochenablauf, all das, was ausschließlich im Kopf stattfindet, der sogenannte „mental load“. Die schiere Menge und Vielgestaltigkeit der Anforderungen im Alltag von Familien kann kaum jemand ermessen, der sie nicht selbst einmal hat stemmen müssen.
Die Sorgelücke und ihre Folgen
Unbezahlte Sorgearbeit, also die Betreuung und Erziehung von Kindern, die Unterstützung und Pflege von Familienangehörigen und die Hausarbeit, ist zwischen Frauen und Männern nicht fair verteilt. Frauen verrichten im Durchschnitt täglich 87 Minuten mehr Sorgearbeit als Männer und wenden damit mehr als anderthalbmal so viel Zeit dafür auf. Die Sorgelücke zwischen Frauen und Männern, der sogenannte Gender Care Gap, beträgt 52 Prozent, in Paarhaushalten mit Kindern 83 Prozent.
Die Corona-Pandemie hat die bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern wie unter einem Brennglas hervortreten lassen und die Gender Gaps noch deutlicher sichtbar gemacht. Das zeigt auch: Die Diskussion über die Umverteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen muss vorangetrieben werden.
Sorgearbeit
Denn die ökonomischen und sozialen Folgen dieser Arbeitsteilung wiegen schwer – vor allem für Frauen: Ihre Einkommen sind häufig deutlich niedriger als die von Männern. Die beruflichen Entwicklungsperspektiven sind oft begrenzt und bei Trennung oder im Alter sind sie finanziell häufig nicht ausreichend abgesichert.
Männern fällt noch immer die Rolle des Familienernährers zu. Das raubt ihnen nicht selten die Zeit, Sorge- und Hausarbeit sowie Pflegearbeit für Familienangehörige zu übernehmen. Den Lebensvorstellungen vieler Paare wird diese geschlechtliche Arbeitsteilung längst nicht mehr gerecht.
Gesellschaftlich zeigen sich die Konsequenzen der ungleichen Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern in der ungleichen Verteilung von Einkommen und Vermögen, beruflicher Positionen sowie politischer und ökonomischer Macht. Die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Sorge- und Hausarbeit steht in keinem Verhältnis zu deren gesellschaftlicher und ökonomischer Bedeutung.
Gleiche Chancen auf wirtschaftliche Eigenständigkeit und Existenzsicherung und die Möglichkeit, Sorgearbeit zu leisten, sind in Deutschland noch immer nicht verwirklicht. Dabei wollen immer mehr Frauen und Männer unabhängig vom eigenen Geschlecht sowohl private Sorgearbeit und Sorgeverantwortung übernehmen als auch den eigenen Lebensunterhalt verdienen können.
Die Vision
Um das zu erreichen – gleiche Verwirklichungschancen für alle Geschlechter – müssen strukturelle Benachteiligungen und geschlechterstereotype Vorstellungen abgebaut werden: Viele Frauen sind fürsorglich, viele Männer auch. Viele Männer lieben ihren Job, viele Frauen auch. Deshalb müssen Sorgearbeit und Erwerbsarbeit als selbstverständliche Elemente weiblicher wie männlicher Lebensverläufe begriffen und möglich gemacht werden, ohne dass dies zu individueller Überforderung führt.
Mit dem Ziel, die geschlechtergerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu fördern und die Sorgelücke zwischen Frauen und Männern zu schließen, haben sich im Sommer 2020 zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure zum Bündnis „Sorgearbeit fair teilen“ zusammengeschlossen.
In dem Bündnis engagieren sich Vertreterinnen und Vertreter aus Kirchen, Gewerkschaften, Frauen-, Männer- und Sozialverbänden sowie aus Selbsthilfeorganisationen und Stiftungen für gleiche Verwirklichungschancen für alle Geschlechter. Sorgearbeit ist von hohem gesellschaftlichem Wert und soll zwischen den Geschlechtern fair verteilt sein. Dafür setzt sich das Bündnis ein. Es versteht sich als Netzwerk, das den Austausch und den gegenseitigen Transfer von Wissen pflegt, gemeinsame Aktionen initiiert, den gesellschaftlichen Wert der unbezahlten Sorge- und Hausarbeit öffentlich sichtbar macht und auf deren volkswirtschaftliche Bedeutung hinweist. Das Bündnis ist offen und begrüßt jede in Deutschland ansässige Organisation, die sich für die geschlechtergerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit einsetzt und sich aktiv im Bündnis beteiligen will.
Seine 13 Gründungsmitglieder haben es sich zum Ziel gesetzt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft für das Thema und die Auswirkungen der sogenannten Sorgelücke (Gender Care Gap) zu sensibilisieren und die Sorgelücke zu schließen.
Die Koordinationsstelle des Bündnisses befindet sich in Trägerschaft des Deutschen Frauenrats. Kontakt: sorgearbeitfairteilen@frauenrat.de
Silke Raab
Das Bündnis „Sorgearbeit fair teilen“